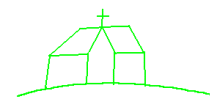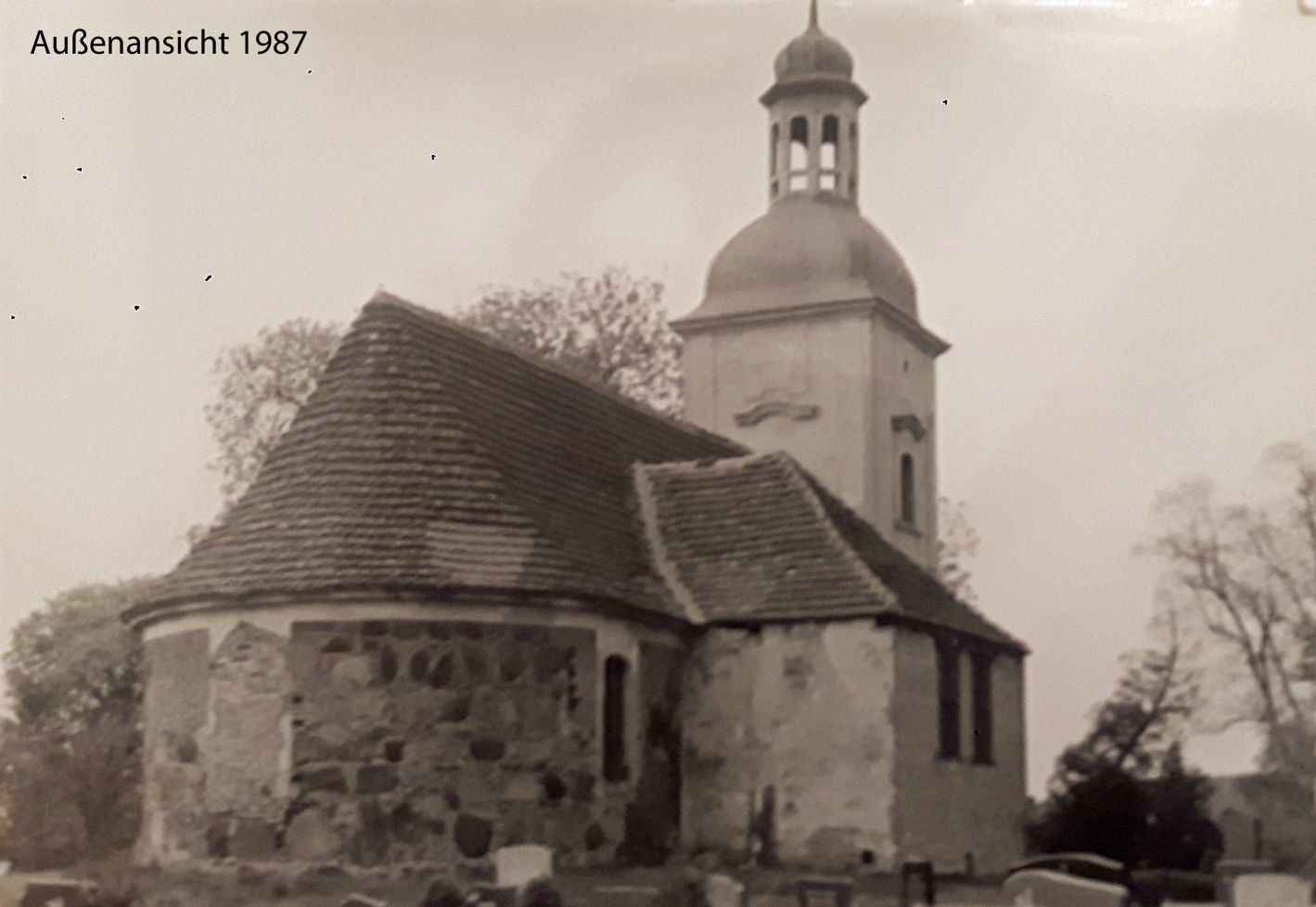|
Unsere Gemeindeteile: |
. Gemeindeteil Gollwitz
| Gollwitzer Ortsgeschichte
Gollwitz ist ein malerisch in der Havelniederung gelegenes Sackgassendorf mit einer Zufahrtsstraße zur B1.
Seit 1993 ist Gollwitz Teil von Brandenburg (mit einer zehnjährigen Unterbrechung, in der der Ort zum Amt Emster-Havel gehörte).
Die erste Erwähnung des Dorfes ist 1375 im Landbuch Kaiser Karls IV. belegt. Seit 1664 stand Gollwitz unter dem Patronat der
Familie von Rochow. Die Prägung des Ortes durch die Patronatsfamilie ist bis heute im Ortskern durch das historische Ensemble
aus Gutshaus (seit 2008 betrieben von der Begegnungsstätte Schloss Gollwitz als Ort der Begegnung für jüdische und nichtjüdische
Menschen - https://www.schlossgollwitz.de), Patronatskirche, Mausoleum und Schlosspark
ablesbar. Im Laufe der Zeit wurde Gollwitz von den Rochows mehrfach verpfändet, verliehen oder verkauft (z.B. an Familie von
Görne oder Familie Tiebe). Das Rittergut von Rochow ist das erste in der Zauche nachgewiesene. Die Bauern- und Kossätenstellen
wuchsen um das Rittergut herum, die guten Böden und die Wiesen und Weiden in den Havelauen sorgten für Wohlstand. Im Jahre
1413 wurde Gollwitz durch die Truppen des Magdeburger Erzbischofs geplündert und niedergebrannt. Im 18. Jahrhundert wurde
zusätzliches Ackerland durch Entwässerung und Grabenlegung gewonnen, außerdem gab es seitdem Schiffereirechte vor Ort.
Die erste Mühle in Gollwitz wurde 1701 errichtet. Noch heute erinnert der Mühlweg daran. 1741 lagerten 30.000 Soldaten
des Regiments Leopolds I. von Anhalt-Dessau für sieben Monate bei Gollwitz; die im Lager ausgebrochene Ruhr-Epidemie
dezimierte auch die Dorfbevölkerung. 1808 legte ein verheerendes Feuer fast das ganze Dorf in Schutt und Asche; der
Wiederaufbau schloss sich sofort an. Ab 1835 setzte als neuer Wirtschaftszweig der Abbau und Handel mit Torf
ein (Verschiffung über die Havel). Ende des 19. Jahrhunderts entstand zudem eine Ziegelei, die zum Gut gehörte.
Die Einwohnerzahl von Gollwitz stieg durch die Industrialisierung von knapp 300 Ende des 18. Jahrhunderts auf
über 470 im Jahre 1925. Knapp 500 Einwohner leben auch heute in dem Ort.
Die Gollwitzer Kirche
Die Gollwitzer Kirche befindet sich am höchsten Punkt des Ortes – jedoch nicht in der Ortsmitte, sondern als
Patronatskirche direkt neben dem Schloss. Die Kirche ist ein spätgotischer Saalbau, der mehrfach umgebaut wurde (1750 unter
Friedrich von Görne; 1823 Einbau der Kanzelaltarwand und klassizistische Umgestaltung im Inneren). Unter der angebauten
Patronatsloge befindet sich eine 1945 von russischen Truppen demolierte Gruft (von Görne), außerdem gibt es zwischen Schloss
und Kirche ein klassizistisches Mausoleum (vom Hagen – von Rochow). In den 1960er Jahren wurden die Kanzel und andere
Ausstattungsstücke entfernt und der Kirchraum in nüchternem Weiß gestrichen. Beim Versuch der Dachsanierung Anfang der 1990er
Jahre entstand weiterer Schaden im Kircheninneren, außerdem wurde die Orgel abgebaut. Bei eine grundlegenden Innenraumsanierung
im Jahr 2021 mit Wiederaufbau der historischen Wäldner-Orgel (von 1869) wird der klassizistische Raumeindruck wiederhergestellt
z.B. durch Nachbau der historischen Empore und Wiederherstellung der ursprünglichen Ornamentik, außerdem werden die
mittelalterlichen Sakramentsnischentüren (u.a. mit spätgotischer Strahlenkranzmadonna) restauriert. Der hölzerne Taufstein
der Kirche ist eine Schenkung der Familie von Rochow aus dem Jahr 1874, die Taufschüssel aus Messing ist eine Nürnberger
Beckenschlägerschüssel aus dem 16. Jahrhundert mit Darstellung der Verkündigung Mariens. Eine der beiden historischen
Bronzeglocken (von 1691) verblieb im Kirchturm, eine zweite wurde im 1. Weltkrieg abgeliefert.
Die Seele von Gollwitz (Beitrag für Blickpunkt Kirche, 2019)
Erst fehlte das Dach, dann fehlten die Menschen - und zuletzt ist der Mut gestorben.
Das ist die neuere Geschichte der Gollwitzer Kirche in einem Satz. So habe ich die Gollwitzer Kirchengemeinde
vor zwei Jahren vorgefunden. Eine einstmals wunderschöne kleine Kirche, aber im Laufe der Zeit verbaut und
vernachlässigt.
Der Mut war gestorben, nicht aber die Hoffnung. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Soweit ist es
nicht gekommen. Durch das kleine Gollwitzer Häuflein ist ein Ruck gegangen. Da geht noch etwas. Und gemeinsam
packen wir das an. Gemeinsam heißt: Die Kirchengemeinde, die Ortsgemeinschaft, die Nachbarn. Die Nachbarn,
die vor wenigen Jahren noch in der Kirche unerwünscht waren.
„Kirchen sind die Seelen der Dörfer“, heißt es in einer Verlautbarung unserer Landeskirche. Es ist in Gollwitz
ein Projekt entstanden, das kein Mensch allein stemmen könnte, sondern bei dem alle lokalen Akteure wie Zahnräder
ineinandergreifen und miteinander planen und arbeiten müssen. Am Anfang stand das bekannte Motto: Wir schaffen das!
Und weil viele das für möglich gehalten haben und beherzt mittun, wird es gelingen, da bin ich mir ganz sicher.
Wir arbeiten nun eng mit unserer Nachbarin, der Begegnungsstätte Schloss Gollwitz zusammen. Über Fördermittel
sanieren wir gerade das kleine Mausoleum und demnächst auch den Kircheninnenraum. Es wird mit Schloss und
Schlosspark ein wertvolles klassizistisches Ensemble entstehen. Aber was nützt das schönste Denkmal, wenn
die Menschen fehlen, die es beleben?
Immer öfter klingelt mein Telefon: Jugendgruppen, Chöre, Familienfreizeiten, interreligiöse Seminare rufen an
und möchten die Kirche sehen und nutzen. Zum Feiern, zum Arbeiten, zu Gottes Lob. Die Gollwitzer Kirchenältesten
haben begonnen, Gespräche im Ort zu führen, angemeldet oder einfach über den Gartenzaun, damit die Kirche wieder
das Zentrum des Dorfes wird, nicht nur historisch, sondern emotional. Die Seele eben.
(Christiane Klußmann)
|
|